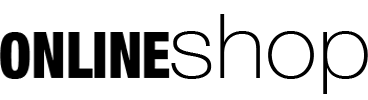Wald DVD-Extras

Für den Wald gibt es keine Zeitrechnung
Interview mit Elisabeth Scharang
Inspiriert ist Ihr Film WALD von Doris Knechts gleichnamigem Roman. Im Film wie im Buch lässt eine Frau um die 40 ihr bisheriges Leben hinter sich und zieht sich ins verlassene Haus ihrer Großeltern zurück. Was verbindet diese beiden Hauptfiguren trotz ihrer unterschiedlichen Geschichten? Was hat Sie an diesem Roman bewegt?
ELISABETH SCHARANG: Es ist die Situation, in der Marian steckt, die mich beim Lesen des Romans so berührt hat. Beide Frauenfiguren, sowohl im Film als auch im Roman, vereint ein Gedanke: Was passiert, wenn mein System zusammenbricht? Diese Frage kennen v.a. selbständig arbeitende Menschen, Frauen, wenn sie auch noch alleinerziehende Mütter sind, noch einmal intensiver. Ich wollte dieser Angst nachspüren und auf der anderen Seite schauen, welche Ressourcen man zur Verfügung hat, auf die wir im urbanen Alltag oft vergessen, weil wir sie nicht brauchen. Ein weiterer Punkt ist die unromantische Facette vom Aussteigen, denn es ist ein erzwungener Ausstieg aus dem gewohnten urbanen Alltag: Im Roman ist es die Finanzkrise, im Film ist es das Nicht-mehr-Zurechtkommen in der Stadt nach dem Trauma des Terroranschlags. Vom Originalstoff habe ich mich Drehbuchfassung für Drehbuchfassung entfernt. Ich habe den Stoff aber dennoch für einige Monate in die Lade gelegt, weil ich den Schlüssel zu meiner Hauptfigur nicht gefunden hatte. Sie war mir fremd geblieben. Kurz nach dem Terroranschlag in Wien habe ich das Buch dann innerhalb weniger Wochen neu geschrieben und es hat sich alles ineinandergefügt. Es brauchte einen Bezug, der den Startpunkt der Figur bestimmte, der nicht mit dem des Romans übereinstimmt, dazu hat sich die Gesellschaft zu schnell entwickelt. Auf die Finanzkrise war die Klimakrise gefolgt und dazu kam die #Metoo-Debatte, das hat die Art wie Beziehungen zwischen Frauen und Männern erzählt werden, doch sehr verändert. Ich gehe aber ohnehin bei Literaturvorlagen immer andere Wege. Auch in meiner letzten TV-Arbeit Die Herznovelle – die ebenfalls auf einer literarischen Vorlage beruhte – habe ich gleich zu Beginn der Drehbucharbeit eine Figur erfunden, die mir geholfen hat, meinen Zugang zu der Geschichte zu finden. Im Fall von WALD ist es Gerti, Marians Jugendfreundin, die uns beiden, mir und meiner Hauptfigur, eine Stütze war. Gerti ist immer da gewesen, auch in den Phasen, wo ich meine Hauptfigur verloren hatte. Es ist schwierig, über einen Menschen zu schreiben, der nicht weiß, wie es weitergehen soll. Die Methode, die für mich funktionierte, war, zu beschreiben, was man sonst nicht beschreibt, nämlich den Handlungsablauf eines Tages: Marian steht auf, sie braucht etwas zu essen, sie braucht Wärme im Haus. Im Setting des Films bekommen sonst selbstverständliche Dinge eine Bedeutung. Ich wusste, es würde unheimlich spannend werden, dieser Frau dabei zuzusehen, wie sie den Tag bewältigt. Es zu schreiben, war alles andere als einfach. Ich habe meine Figur in keinen Plot gezwängt, vielmehr bin ich ihr gefolgt und war manchmal genauso überrascht über ihren nächsten Schritt wie sie selbst. Wir konnten den Weg gemeinsam gehen und das war erst nach dem 2. November 2021 möglich.
Welche Kernerfahrung haben Sie über Ihre Hauptfigur Marian in dieser späten Drehbuchphase verarbeitet?
ELISABETH SCHARANG: Eine erste Kernerfahrung teile ich, so glaub ich, mit vielen Menschen in dieser Stadt mit dem Umstand, dass sie ihre Erfahrung an diesem Abend gar nicht oder nur ganz wenigen Leuten erzählt haben, weil ihnen (wie mir) ja körperlich nichts passiert ist. Nach einem Abend, an dem Menschen ermordet und schwer verletzt worden sind, hat man – so war mein Eindruck – als jemand, der körperlich unversehrt geblieben ist, kein Recht auf einen Opferstatus. Es war ganz schwierig, aber wesentlich, selbst anzuerkennen, dass mir etwas passiert ist. Das war nur über das Schreiben möglich. Über das gesprochene oder geschriebene Wort wird eine Erfahrung ausgeleitet. Es nur zu denken, ist manchmal zu wenig. Wenn man so wie ich in einem Bereich arbeitet (Anm. Dokumentarfilm und Journalismus), wo ich sehe und höre, was Menschen erleiden und darüber hinwegkommen müssen, dann entsteht das Gefühl, dass mir dieser Raum nicht zusteht. Mein Körper hat das allerdings anders gesehen, weil er es zum Glück besser weiß; ich habe ein gut funktionierendes inneres Leitsystem, das einschreitet, wenn ich mir zu viel zumute. Und das war im November 2021 so. Und das ist auch bei meiner Hauptfigur Marian so. Wenn mein Körper etwas einfordert, dann weiß ich, es ist optionslos. Dass Marian die Stadt verlässt, ist eine körperliche Forderung. Sie muss weder darüber nachdenken, warum sie geht, noch darüber, was sie dort erwartet.
Wenn Marian auf ihrem Weg von Wien ins Waldviertel im Zug sitzt, sieht man nur ihr Spiegelbild im Zugfenster. Ist es auch nur ein Teil – der ungreifbare Teil von ihr? – der sich auf den Weg macht?
ELISABETH SCHARANG: Das ist ein richtiger Gedanke. Es geht darum, eine Frau auf einer Reise zu begleiten, die ihre zersprengten Teile wieder zusammensetzt. Es gibt immer wieder Ereignisse im Leben, die einen innerlich in Stücke reißen. Es gibt dadurch aber auch die Möglichkeit, sich wieder zusammenzubauen und zwar nicht unbedingt in der ursprünglichen Konstellation. Man baut sich selbst über Erfahrungen, Reflexionen, Wissen, das man sich aneignet, Therapien, Rückschläge nach und nach zusammen. Was man – im besten Falle – als kleines Kind war, sofern man ohne ein traumatisches Erlebnis auf die Welt gekommen ist, wird über Einflüsse von außen in Teile zersetzt. Irgendwann setzt der Prozess der Eigenermächtigung ein mit der Frage: Welche Person möchte ich sein? Diese Frage stellen wir uns meist nur, wenn wir Krisen haben. Die Attentatserfahrung ist so eine Krise. Im Laufe ihrer Reise kommt Marian aber drauf, dass die eigentliche Zersprengung ihrer Person, nicht in dieser Terrorerfahrung liegt, sondern viel tiefer. Was sie von der tieferliegenden Erfahrung mitgenommen hat, sind die Reaktionsmuster darauf: Ich laufe weg, ich ändere mein Leben, ich schau mir das nicht an, weil der Schmerz zu groß ist. Jetzt ist sie so weit, dass sie es aushalten wird. Sonst kann man sich nicht auf diese Reise begeben. Sie ist genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
Ein zentraler Satz lautet: Thinking about the future is overwhelming me. Thinking about the past makes me sad. The only place I want to be at the moment is here. An welchem Punkt in ihrem Leben ist Marian angekommen, dass sie so etwas sagt?
ELISABETH SCHARANG: Man muss es aushalten können, zu wissen, man ist jetzt da, hat aber keine Ahnung, wohin es gehen wird. Diese Fläche, die man sich so oft wünscht und selten zulässt – nämlich, dass nicht alles mit Plänen zugebaut ist – ist beängstigend. Es ist auch eine Zumutung ans Publikum, die ersten fünfzehn Minuten, in denen so gut wie nichts geredet wird, auszuhalten. Ich habe es ja sehr gern, wenn nicht ständig geredet wird. Es gibt aber Menschen, die es als bedrohlich erleben, wenn der eigene Gedankenfluss und die inneren Stimmen so stark in den Vordergrund rücken und hörbar sind. Darum ist Ablenkung für uns so wichtig. In dem alten Haus ohne Elektrizität ist man mit den Möglichkeiten der Ablenkung bald am Ende angelangt.
Daher auch Marians befreiende Schreie in den Wald hinein?
ELISABETH SCHARANG: Der Schrei ist etwas ganz Besonderes, weil es in unserem urbanen Alltag dafür keinen Raum gibt. WALD ist ein Film, in dem es um Kontrollverlust geht und ich meiner Figur letztlich alles zumute, was ich selber an Erfahrungen vermisse. Ich bin grundsätzlich kein lauter Mensch, ich vermisse aber die Räume, in denen ich das sein könnte, ohne Täterin zu werden. Es geht mir nicht darum, Leute anzubrüllen, aber darum, manchmal zu schreien. Es gibt viele, Dinge, die ich Brigitte zugemutet habe. Dass WALD so ein persönlicher Film ist, war eine Erkenntnis, zu der ich erst an den allerletzten Drehtagen gekommen bin. Absurd. Ich habe das Drehbuch selbst geschrieben, aber dennoch nicht empfunden, wieviel es mit mir selbst zu tun hatte. In der Probe für die Szene, wo sie Franz ihre Attentatserfahrung erzählt, war Brigitte sehr unrund, weil es für irritierend war, diesen Dialog zu spielen, wissend, dass die Person, die diese Erfahrung gemacht hat, direkt hinter ihr stand. In dem Moment bekam ich die Gelegenheit, meine eigenen Puzzleteile zusammenzusetzen und mir bewusst zu werden, dass ich nichts mehr gewollt habe, als diese Monate im Wald zu sein. Brigitte hat in der Rolle der Marian Vieles gemacht, wo ich intuitiv das Gefühl hatte, ich würde sehr gerne mal den Mut haben, mich dem auszusetzen, weil es sich wie maximale Freiheit anfühlt. Freiheit heißt, vieles nicht zu brauchen, was in der Stadt Bedeutung hat: z.B. Anerkennung und alles, was da dranhängt, was einen antreibt, manchmal auch anfrisst; es einfach gehen zu lassen, weil ich weiß, dass die Dynamik von Erfolg und gesellschaftliche Anerkennung so wenig nachhaltig ist und auf einer Wertehaltung basiert, die ich ohnedies nicht teile. Sich zurückziehen. Zu wissen, dass es nur darum geht, zu sein. Marian dabei zuzuschauen, wie sie sich all das nimmt und sich zusammenbaut, war eine tolle Reise.
Der Wald spielt eine sehr wesentliche visuelle Rolle. Sie zeigen den Wald von außen, von innen von oben – abweisend, angsteinflößend, beruhigend, schützend. Was repräsentiert der Wald für Sie? Warum haben Sie die Herbstmonate für den Dreh gewählt?
ELISABETH SCHARANG: WALD beginnt in einer Herbstphase, die noch die ganze Fülle von Frühling und Sommer in sich trägt. Die Kraft der Farben, der Natur, der Jahreszeiten sind das Wesen des Films. Man hätte WALD ohne Dialoge erzählen können, weil die Natur die innere Reise der Figur 1:1 abbildet. Die bunten Bäume repräsentieren das Außen wie die Kleidung, wie alles, was wir haben, um uns zu zeigen. Im späten Herbst fällt das ab und die Purheit bleibt; dann geht es nach innen, indem sich der erste Frost über die Felder legt und die Erde verschließt. Nichts gelangt mehr durch, es bleibt die Innenschau. Der Boden ist hart, die Innenschau ist es auch. Es gibt keine Geborgenheit. Der Regen wäscht Vieles weg, bringt auch Vieles herein. Der Schnee, der alles zudeckt, bedeutet am Land auch, dass Ruhephase für die Bauern ist. Der Winter ist keine bedrohliche Zeit, sondern eine der Ruhe und der Heilung. Auch das hat einen Frieden. Die Natur zeigt, wo Marian gerade steht und hilft, diese Innenschau nach außen abzubinden. Das berührend Schöne an der Natur ist, dass sie einfach da ist. Was sich ändert, ist unsere Perspektive darauf. Gehen wir bei Sonnenschein in den Wald, dann reflektiert er das Abenteuer, das Behütet-Sein, die Freude. Wird es dunkel, ist er mitunter die Projektion für alle unsere Ängste. Es ist aber immer derselbe Wald. Es bedarf manchmal – ganz simpel – auf das eigene Leben einen anderen Blick zu werfen. Man nennt das wohl Perspektivenwechsel. Der Wald zeigt uns das in all seiner Geduld auf wunderschöne Weise. Es gibt für ihn keine Zeitrechnung.
WALD erzählt eine sehr persönliche Geschichte, aber auch von vielen Kluften im großen Ganzen: zwischen Land und Stadt, zwischen den Träumen der Kindheit und der Realität des erwachsenen Lebens, zwischen Männern und Frauen, zwischen Bleiben und Weggehen, zwischen Widerstand und Akzeptanz. Was ist Ihnen in dieser Auseinandersetzung mit dem Dorf ein Anliegen gewesen?
ELISABETH SCHARANG: Als Mensch, der nicht am Land lebt, hatte ich sehr großen Respekt davor, über eine Welt zu erzählen, die ich so nicht kenne. Die intensiven film- und gesellschaftspolitischen Diskussionen in den letzten zwei Jahren mit Kolleg*innen bei DieRegiesseur*innen z.B. bei unseren Veranstaltungen von feminist perspectives, haben mir extrem viel bei meiner Arbeit geholfen, um Geschichten differenzierter zu erzählen. Meine eigene Lebensrealität ist nicht so divers, wie die Welt, die ich in Filmen abbilden möchte. Zu lernen, als Autorin die richtigen Fragen zu stellen, Fragestellungen zu erweitern, das ist sehr wichtig und macht Stoffe interessanter. Ich denke an die Figur des Franz. Es war nicht einfach, eine Zuschreibung von Männlichkeit, die man von dieser Figur erwartet, zu brechen. Vor dieser Aufgabe stand ich auch bei anderen Rollen. Zum Beispiel beim Bauern im Wirtshaus. Heinrich Mayr ist als Mensch das genaue Gegenteil seiner Figur. Es war für ihn schwierig, einen latent aggressiven Menschen darzustellen. Ich wusste aber, dass dieser Bauer genau diese Verletzlichkeit in sich trägt. Es ging bei allen Figuren darum, sie auszutarieren. Auch Marian ist keine nur sympathische Figur. Wie wir alle, haben auch meine Figuren ein Potpourri aus verletzlichen und verletzenden Seiten, von denen man nicht ablässt, obwohl es um Beziehung und Freundschaft geht. Ich kenne nicht viele Filme, in denen über Freundschaften zwischen Menschen, die sich schon lange kennen, erzählt wird, ohne, dass es vorrangig um Kinder oder Elternschaft geht. Menschen, die einen aus einem Leben „davor“ kennen, mit denen man immer andocken kann. Familie ist ja auch deshalb Familie, weil es sich um die Menschen handelt, die dich immer schon kennen. Das ist mitunter unangenehm. Gerti und Marian fallen aber nicht in ihre alten Rollen zurück, sondern definieren sie neu. Wenn man das schafft, dann sind das Beziehungen, die alles überdauern. Solche Freundschaften sind überlebensnotwendig.
Bestimmend für die Lebensentscheidungen von Marian und Gerti ist die von Männern ausgeübte physische Gewalt. Ein wichtiger Moment ist der, dass bei einer Auseinandersetzung im Gasthaus Marian zuerst zuschlägt. Was bedeutet es, dass eine Frau diesen ersten Schritt zur Gewalt setzt?
ELISABETH SCHARANG: Ich finde jede Form von körperlicher Gewalt ist eine massive Grenzüberschreitung. Ein wesentlicher Punkt in Marians Geschichte ist der, dass sie die Erfahrung vom frühen Tod ihrer Mutter wie eine dichte Kapsel verschlossen hatte. Als sie das volle Wirtshaus betritt, hat sie mit einer Panikattacke zu kämpfen, und genau in dieser Situation verletzt sie der Bauer absichtlich, in dem er etwas abwertend Sexistisches über ihre Mutter sagt. Marians Gegenschlag ist wie eine Explosion. Es kommt so viel zusammen, dass sie diese Spannung so ausagiert, was nicht heißt, dass ich das für gut befinde. Was ich aber trotzdem sagen muss – Ich hatte große Lust, eine Wirtshausschlägerei zu inszenieren, in der eine Frau die agierende Hauptrolle spielt. Was den Aspekt der häuslichen Gewalt bei Gertis Lebensentscheidung interessant macht, ist die Zweischneidigkeit. Gerti hat sich über die Jahre eine Rolle zugeschrieben, die sie als Opfer von der jahrelangen Gewalt durch ihren Vater von der Entscheidung, den Hof und die Eltern zu verlassen entbindet. Ihr Blick aufs Leben ist klar: Es gibt Verlierer und Gewinner. Gerti zählt sich zu den Verlierern. Als Kind konnte sie sich ihre Lebenssituation nicht aussuchen, irgendwann wird es aber zu ihrer Entscheidung. Marian konfrontiert sie mit der Frage, warum sie trotzdem geblieben ist. Als Außenstehender mit häuslicher Gewalt umzugehen, ist für viele Menschen unangenehm, sie wissen oft nicht, wie man reagieren soll, wenn man Zeuge wird. Für Marian ist das anders. Sie schaut hin und spricht es an, was Gerti auch mit Scham erfüllt. Spannend wird es in der Beziehung zwischen den beiden, wenn sich etwas bewegt und wenn Marian ihrerseits abhängig wird von der Hilfe ihrer Freundin. Wenn man in so einer Situation sich einander zumuten kann, dann ist das tiefe Freundschaft. Beide erleben Momente, wo sich die eine der anderen zumuten muss. Im Laufe des Schreibens hat sich diese Freundschaft zwischen den beiden Frauen für mich als Kern der Geschichte herausgebildet.
Johannes Krisch und Gerti Drassl sind zwei Schauspieler*innen, mit denen Sie schon gearbeitet haben. Brigitte Hobmeier hat eine sehr kraftvolle, stille, uneitle Rolle zu tragen. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit ihr?
ELISABETH SCHARANG: Wir sind einander vor Jahren bei der Verleihung des Volksbildungspreises begegnet, wo wir beide ausgezeichnet worden sind. Bei mir ist es so, dass ich Kolleg*innen, die mich berühren, in meiner Gedächtnisschublade habe, die ich unter „mit dir werde ich mal arbeiten“ abspeichere. Das dauert manchmal. Für die Rolle der Marian stand Brigitte Hobmeier von Anfang an fest. Da gab es kein Casting. Es war klar, dass ich eine moderne Frau erzählen wollte und ich wusste, dass ich ein sehr starkes Gesicht brauchte, dem man folgt; ein Gesicht, das sich in den Wald einfügt und immer auch abhebt zugleich. Sie ist einfach da und das ist oft genug. Gerti Drassl hat in meinem ersten Spielfilm Mein Mörder eine ihrer ersten Filmhauptrollen gespielt und es hat mich riesig gefreut, dass wir wieder zusammenarbeiten konnten.
Die Drehorte scheinen sehr kompakt beisammenzuliegen. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit den Dreharbeiten?
ELISABETH SCHARANG: Für mich war WALD der schönste Dreh, den ich bisher hatte. Am liebsten würde ich nie wieder in der Stadt drehen. Ich habe es geliebt, dass ich die Natur nicht unter Kontrolle hatte und mich auf alles einstellen musste. Wir haben nie gegen die Natur gearbeitet. Wir haben genommen, was da war und den Drehplan immer wieder umgestellt. Ob Nebel, Sonne, Regen… es war ein Geschenk. Für das Team war es sicher nicht immer einfach. Für die Szene am Friedhof hatten wir einen Schneesturm, der uns die Eiskörner waagrecht ins Gesicht geschleudert hat. Der Sturm war so laut, dass wir einander anschreien mussten, um zu kommunizieren. Für diese Szene hätte es keine besseren Witterungsbedingungen geben können. Die Dialoge dort sind übrigens Originalton, wir mussten nichts davon nachsynchronisieren. An diesem Tag war auch die Szene geplant, in der Marian und Gerti über das schneebedeckte Feld rennen und dann in einen alten gemeinsamen Song einstimmen. So etwas will man nicht synchronisieren, also dachte ich daran, die Szene zu verschieben, hab den beiden Schauspielerinnen aber offengestellt, es zu probieren. Wir sind mit ihnen free flow über das Feld gerannt in diesem Schneesturm und am Ende war es die beste Entscheidung. Auch da ist übrigens alles Originalton. Wir sind also der Natur gefolgt und es war immer richtig. Zwei Drehblöcke für den Hauptdreh waren geplant und wir konnten tatsächlich alles in einem Block drehen: Wir haben im bunten Herbst begonnen, es gab Nebel, Frost, Regen und zwei Wochen vor Drehschluss kam der Schnee. In diesem Film gibt es keinen digitalen Effekt, alles Natur pur. Marians Haus und Gertis Haus lagen auf einem Hochplateau und waren wie ein großes begehbares Filmset für uns. Das Haus im Film klingt so, weil wir so viel Originalton dort machen konnten. In dem Haus hatte eine alte Frau gelebt, die zwei Jahre vor dem Dreh verstorben war. Die Familie, die uns das Haus zur Verfügung gestellt hat, beließ Vieles so, wie es deren Oma hinterlassen hatte. Wir haben die alte Frau, die frühere Besitzerin des Hauses, als Marians Großmutter und als Teil ihrer Erinnerungen im Film verewigt. Es war so viel Spirit und Atmosphäre in diesem Haus, die von der echten Biografie einer Frau, die dort geboren und gestorben ist, erzählt. Das Haus hat uns sehr liebevoll aufgenommen.
Etwas, das sich ebenso stimmig ins Ganze fügt, ist die Musik. Wie kam Hania Rani ins Projekt?
ELISABETH SCHARANG: Bei allen meinen anderen Filmen wusste ich bereits vor dem Dreh, welche Filmmusik ich verwenden wollte, weil die Musik wie eine weitere Dialogspur für mich ist. Bei WALD hatte ich Ideen, konnte mich aber nicht entscheiden. Ich wusste lange nicht, wie der Film, wie der Wald klingen würde. Während des Schnitts bin ich, obwohl ich selten Youtube-Videos schaue, auf ein solches gestoßen – eine 35-minütige Studio-Session von Hania Rani mit Elektronik und Klavier. Sie hat eine Art, Musik zu machen, in der man in jede Sekunde den Menschen hinter dem Sound spürt. Sie nimmt ihre Musik extrem haptisch auf, so dass man jede Berührung der Klaviertasten und jeden Atem hört. Wenn sie singt, dann fliegt die Musik. Das Management hat unsere Anfrage milde belächelnd beantwortet: keine Zeit und zu teuer für unsere Vorstellungen. Sie war zu dem Zeitpunkt auf Welttournee und arbeitete am Score für eine internationale Serie. Ich habe sie trotzdem persönlich angeschrieben und nach einem Konzert im Wiener WUK getroffen; ich wollte nur, dass sie sich den Rohschnitt anschaut und falls sie tatsächlich keine Inspiration hat, während sie den Film schaut, dann würde ich sofort loslassen, aber sie hat den Film angeschaut und zugesagt. Es war nicht einfach, denn normalerweise geht man mit der Musik in den Schnitt. Im Fall von WALD ist die endgültige Musik erst peu à peu dazugekommen, bis wir schon in der Mischung waren. Das gesamte Team von Sounddesign und Mischung hat hier alles gegeben, damit das funktioniert. Aber es ist jede Sekunde wert.
Interview: Karin Schiefer | AUSTRIAN FILMS
August 2023
RAPHAELA EDELBAUER zum Film „WALD“
Raphaela Edelbauer ist Autorin der Romane „Das flüssige Land, „DAVE“ und „Die Inkommensurablen“, der im Herbst im Volkstheater als Theaterstück uraufgeführt wird. Edelbauer erhielt 2018 den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, stand 2019 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, erhielt 2021 den Österreichischen Buchpreis. Sie ist zurzeit eine der innovativsten jungen Autorinnen in Österreich.
„Wenn es für mich in den Tagen nach der Nacht des 2. Novembers, der Nacht des Terroranschlags auf dem Schwedenplatz in Wien, eine Erfahrung gab, die mich erschütterte, dann war es das Gefühl, mit niemandem, der nicht mit dabei war, darüber sprechen zu können. Da waren Worte, aber ein im Erklären abhandengekommener Sinn. Da waren Erinnerungen, aber sie schienen keinen Inhalt zu haben, sondern nur ephemere Stimmungen, die sich entzogen, sobald ich sie chronologisch zu schildern versuchte. Ich hatte nach einer Lesung meiner Partnerin, die in der Alten Schmiede ihren neuen Roman vorgestellt hatte, zweihundert Meter Luftlinie vom Schwedenplatz in der Schönlaterngasse gestanden. Dort, im Büro des Kunstvereins zu zwanzigst zusammengedrängt, würden wir bis drei Uhr nachts bleiben, um dann – aufgewühlt und verwirrt – durch eine dystopisch scheinende Innenstadt nach Hause zu flüchten. Zum Glück war niemandem von uns im eigentlichen Sinne „etwas geschehen“ – und trotzdem wuchs in den darauffolgenden Tagen und Wochen das Gefühl, dass sich etwas Einschneidendes zugetragen hatte, das nur schwer zu formulieren war.
„Ich bin gar nicht verletzt worden“, sagt Marian, die Protagonistin von Elisabeth Scharangs Film „Wald“, in der einzigen Szene, in der sie direkt über jenes Erlebnis in der Terrornacht spricht, aufgrund dessen sie alle weltlichen Verbindungen abgebrochen hat, um in ihrem Heimatdorf ein feindliches Refugium zu finden. Die erfolgreiche Investigativjournalistin hat in den letzten Jahrzehnten das Dorf gemieden, sich bei niemandem gemeldet. Und doch zieht sie nun, nach dieser Zäsur, wieder in das Haus der verstorbenen Großmutter zurück – alleine und ohne Strom, unter ein tropfendes Dach und in die klirrende Kälte. Zuerst scheint sie sich selbst so wenig einen Reim auf ihre Reaktion machen zu können, wie die Zuseher*innen. Für die erste halbe Stunde rätselt man, was genau es ist, das diese Frau, die mit 16, alle Verbindungen kappend, aus ihrer Heimat geflohen ist, just dorthin zurücktreibt.
Das Trauma, das alles ins Rollen bringt, nimmt nicht mehr als zwei Minuten im eigentlichen Sinne ein, und ich bin der festen Überzeugung, dass das der Grund ist, warum der Film so präzise fasst, was Trauma eigentlich ausmacht. Marian läuft wie gehetzt durch die feuchten Täler, schleppt Lebensmittel in ihre Einöde und wird von den Dorfbewohnern angepöbelt. Aber da ist etwas in dieser Landschaft, dass sie von der Panik, die sie in Wien immer wieder heimsuchte, kuriert, und dass sie in den dichten Wäldern ihrer Kindheit findet.
Fern davon, dass eine analytische Aufarbeitung, eine wie man sagt „Charakterentwicklung“ verhandelt wird, spiegelt sich das emotionale Vakuum in dem, was nicht da ist: urban-eindeutige Struktur, Strom, Wärme, klare Sicht im dauervernebelten Tal. Worte, die den Kreislauf des Schweigens durchbrechen könnten.
Diese Weise, den Stoff zu erzählen, eine Weise also, in der nicht das traumatische Ereignis, sondern die Lebenszeit, die danach kommt, in den Mittelpunkt gerückt wird, macht den Film universal. In Doris Knechts Roman „Wald“, der Scharangs Drehbuch inspiriert hat, ist es nicht ein Terroranschlag, sondern eine existenziell bedrohliche Finanzlage, die zum Regress der Hauptfigur führt. Beiden Marians ist die vom Umfeld als übertrieben empfundene Reaktion gemein, und auch, dass sie schon einmal ganz ähnlich getriggert wurde.
Marian kommt nämlich nicht geschichtslos ins Dorf: Dass ihre ehemaligen Freunde Franz und Gerti gleich zu Beginn so ablehnend auf ihre Präsenz reagieren, liegt daran, dass sie nach dem Tod ihrer Mutter vor etlichen Jahren eine ebenso „irrationale“ Reaktion zeigte. Sie hatte damals das feste Versprechen, nur gemeinsam mit Gerti das Dorf zu verlassen, nicht eingehalten, und sich bei den Menschen, die ihr am nächsten standen, nie wieder gemeldet. Überstürzte Flucht und das Abbrechen aller Verbindungen – das ist ein Schema, das sich in Marians Leben wiederholt.
Was man dabei leicht übersieht, ist, dass die beiden anderen ebenso widersprüchlich reagieren: Franz, ehedem ein Rebell mit Auswanderungsplänen nach Südamerika, betet Marian, als er sie im Auto mitnimmt, eine Reihe bürgerlicher Werte herunter, die ihn dazu veranlasst haben, sein ganzes Leben im angeblich so verhassten Dorf zu verbringen. Die beste Kindheitsfreundin Gerti ihrerseits hat nach einer Liaison mit Franz den elterlichen Hof übernommen und pflegt den wütenden Vater und die demente Mutter ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben.
Das Besondere am Verhältnis vor allem der beiden Frauen ist dabei aber nicht, dass sie beide „unterschiedliche Lebensentwürfe“ präsentieren; ein Topos der in Antiheimat-Sujets und Auseinandersetzung von Städtern mit der eigenen ländlichen Herkunft zuhauf auftritt. Vielmehr ist es das Unwahrscheinliche, das Außergewöhnliche, das, was sie noch immer gemeinsam haben. Warum nur sehnt sich die dekorierte Reporterin plötzlich nach der Bestätigung einer Bäuerin? Warum akzeptiert Gerti im Laufe der Handlung ihre Freundin doch, wenngleich das, was sie getan hat, nicht verziehen und nicht rückgängig gemacht werden kann?
Jenes Gemeinsame, das Wiedergewinnen des Vertrauens, wird nicht ausbuchstabiert, sondern in Augenblicken gemeinsamer Zigaretten oder einer wortlosen Autofahrt neu errichtet. Die Beziehungen der Figuren zueinander zeigen sich nicht im dialogischen Schlagabtausch, sondern in der Annahme von dem, wovon man nicht weiß, was genau es ist. Gerti, die nach dem Suizid ihres Vaters auf dem Höhepunkt der Handlung ihren eigenen Paradigmenwechsel erlebt, ist zum Schluss auf dem Weg in ein eigenes Leben. Und doch gibt sie zu, dass sie nicht weiß, woran sie sich dabei orientieren soll.
Es wäre ein Fehler, im Verständnis von der „Wald“, der Versuchung nachzugeben, diese irreduzible Komplexität des menschlichen Verhaltens auf simple Dichotomien herunterzubrechen. Marian flieht nicht etwa vor der zur Gefahrenzone gewordenen Stadt in die unschuldige Natur, um sich dort im eigenen Urzustand zu finden. Ganz im Gegenteil; ist doch die Gewalt – in Worten und Taten – im Dorf omnipräsent, sodass die Intellektuelle in einer Szene zur Wirtshausschlägerin wird.
Scharangs Film stellt sich den Paradoxien, wobei die ultimative jene ist, dass ein zweiter Riss unter gewissen Umständen einen ersten kitten kann. Es ist nicht allein die Tatsache, dass Marian die einst abgebrochenen Verbindungen wiederherstellt, sondern auch, dass der zweite Schuss, der trifft und tötet, es für sie erst erträglich macht, sich mit dem ersten auseinanderzusetzen.
Was hier psychologisch geschieht, transzendiert gewissermaßen eine Wenn-Dann-Logik. Aber ich bin doch gar nicht verletzt worden. Eigentlich nicht verletzt zu sein, bedeutet auch: eigentlich nicht geheilt werden zu können, wenigstens nicht so, wie man sich das vorstellt. Wird Marian wieder fliehen, wenn etwas ihr Leben aus den Fugen bringt? Wir wissen es nicht. Und gerade, dass Wald nicht mit aufklärerischem Impetus eindeutige Antworten nahelegt, ist die Stärke dieses Filmes.“
Presseheft